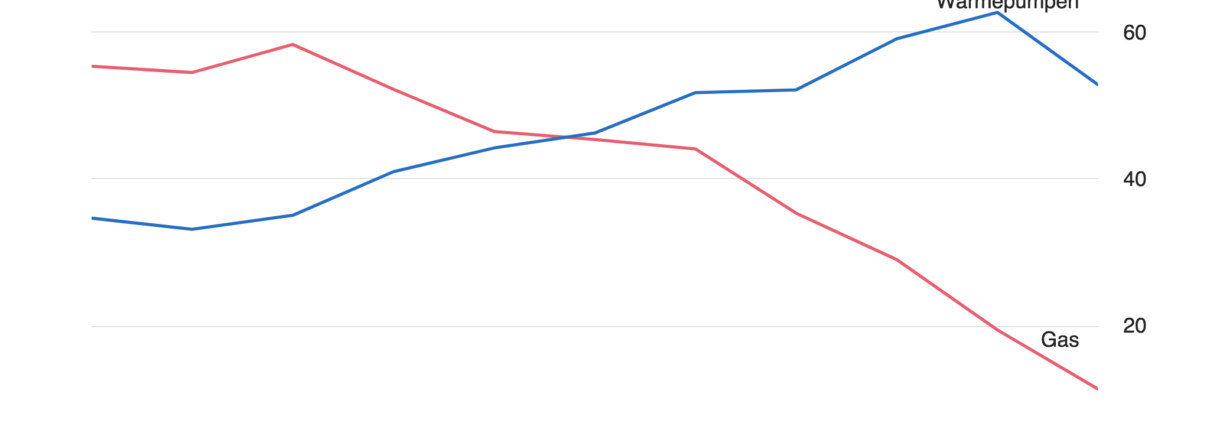Der Immobilienmarkt hat für außenstehende Beobachter derzeit den Anschein eines lebhaften und bunter Marktes, wie man ihn aus fernen, exotischen Ländern kennt. In solch einer komplexen und dynamischen Branche ist es ratsam, auf das Wissen von Experten zurückzugreifen, insbesondere bei wesentlichen Entscheidungen.
Ein prominentes Unternehmen, das die Entwicklungen auf den internationalen Immobilienmärkten analysiert, ist das Beratungsunternehmen Savills. Mit fundierten Kenntnissen in über 70 Ländern und umfassender Expertise in Gewerbe- und Wohnimmobilien, untersucht das Unternehmen aktuell den deutschen Immobilienmarkt.
Der Bericht zeigt auf, dass der deutsche Immobilienmarkt einen tiefgreifenden Wandel durchläuft. Das Ende der Nullzinspolitik markiert den Beginn eines neuen Marktzyklus, der sich jedoch grundlegend von seinem Vorgänger unterscheidet. Zwei zentrale Aussagen heben die Berater hervor: Erstens, es wird keinen „Superzyklus“ mehr geben. Zweitens, der neue Zyklus beginnt in einer völlig veränderten gesellschaftlichen und technologischen Landschaft.
Dieser Wandel bringt neue Anforderungen an Immobilienprofis mit sich. Der letzte Marktzyklus profitierte von einem einmaligen Zusammenspiel aus starkem Bevölkerungswachstum, einer boomenden Wirtschaft und sinkenden Zinsen – der sogenannte „Superzyklus“. Doch diese Zeiten sind vorbei. Der neue Zyklus wird sich durch eine stärkere Fokussierung auf Mieterträge auszeichnen. Die Unterschiede zwischen den verschiedenen Immobilienstandorten und -segmenten werden immer deutlicher.
Darüber hinaus starten wir in einen Zyklus, der von gesellschaftlichen und technologischen Veränderungen geprägt ist. Neue Anforderungen an Flächen und die Bedürfnisse der Nutzer polarisieren den Markt zunehmend. Themen wie ESG (Environmental, Social, Governance), Digitalisierung, Homeoffice, der Online-Handel und der Einsatz von Künstlicher Intelligenz spielen eine immer größere Rolle und beeinflussen die Immobilienmärkte.
Der Wandel stellt Eigentümer und Investoren vor neue Herausforderungen. Eine präzise Beratung und gründliche Marktanalysen werden künftig noch wichtiger. Insbesondere im Gewerbeimmobilienmarkt steigen die Anforderungen, aber auch private Immobilieninvestoren werden in Zukunft von einer professionellen Beratung profitieren.
Foto: © Whitesession, Pixabay